Petershagen / Münster – Ein Fund aus Gold: Über 1600 Jahre hat es gedauert, dann kam der Richtige des Weges und förderte Güldenes zu Tage. Constantin Fried, lizenzierter Sondengänger, war im Kreis Minden-Lübecke unterwegs, als ihm „Einzigartiges in Europa“ unters Suchgerät kam. Ein goldenes Minischloss aus der Römerzeit.

Das Miniatur Dosenschloss aus Gold ist kleiner als eine Ein-Euro-Münze – Foto LWL / Stefan Brentführer
Es misst 1,2 mal 1,1 Zentimeter, ist kleiner als eine Ein-Euro-Münze, aber viel, viel wertvoller.„Dass wir hier in Westfalen mit so hochkarätigen Funden aufwarten können, begeistert mich“, so Dr. Georg Lunemann, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), bei der Fund-Präsentation in Münster.
„Ich konnte es selbst kaum glauben“
„Ich konnte es selbst kaum glauben, als ich den Fund in der Hand hielt“, berichtet Fried. „Denn solche römischen Schlösser sind normalerweise viel größer und bestehen aus Eisen oder auch bronzenen Teilen.“ Auf einem Acker in Petershagen-Frille hat er die goldene Feinarbeit entdeckt. Dass es sich dabei um ein sogenanntes Dosenschloss handelt, da hatten die Expertinnen und Experten keine Zweifel. Der Fund war äußerlich baugleich mit solch regulären römischen Schlössern. Die dienten dazu, Truhen und ähnliches vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Miniatur aus Gold datiert LWL-Kulturdezernentin und Archäologin Dr. Rüschoff-Parzinger mit Blick auf „Form, technischen Aufbau und Verzierungsstil“ in das 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus.
Dr. Michael Rind, Direktor der LWL-Archäologie, unterstreicht die Bedeutung des Fundes: „Es ist der bisher nördlichste Fund eines Dosenschlosses in Deutschland.“ Vergleichbares habe es in Europa noch nicht gegeben. Es stellen sich viele Fragen, unter anderem eine technische: Hat das Schloss trotz seiner geringen Größe einen funktionstüchtigen Mechanismus? Um das herauszufinden, musste hochmodernes Gerät ran. Die Bordmittel des LWL reichten nicht ganz, um Klarheit zu schaffen. Schweizer Expertise war gefragt. Dr. David Mannes und Dr. Eberhard Lehmann vom Paul Scherrer Institut (PSI) in Villingen setzten einen „3D-Neutronen-Computertomografen“ ein. Der sorgte für ausreichend Einblicke. Ergebnis: Das Schloss hat funktioniert. Das zeigt auch ein Nachbau. Ein Restaurator der LWL-Archäologie stellte einen voll funktionstüchtigen Nachbau her, viermal größer als das Original.
Kulturdezernentin Rüschoff-Parzinger weist darauf hin, dass sich nicht nur technische Fragen stellen. Der Fund gebe auch neue Hinweise auf die Beziehungen zwischen den einheimischen Eliten in Westfalen und dem Römischen Reich sowie auf die mögliche lokale Bedeutung seines Fundplatzes.
- Das römische Miniatur-Dosenschloss und seine vergrößerte Rekonstruktion sorgen für große Begeisterung bei Dr. Georg Lunemann, dem Direktor des LWL, und LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. Im Hintergrund Dr. Ulrich Lehmann vom Sachgebiet Sondengehen und Magnetangeln und Dr. Julia Hallenkamp-Lumpe von der Außenstelle Bielefeld, LWL-Archäologie für Westfalen – Foto LWL / Julia Großekathöfer
- Das goldene Fundstück in der Erde – Foto LWL / C. Fried
- Der nachbearbeitete Datensatz der Neutronen-CT macht den inneren Mechanismus des Schlosses sichtbar: Rahmen mit Feder (rot), Riegel (blau), abgebrochene Riegelführung (gelb), Dorn für den Schlüssel (grün), Bodenplatte (lila) und eingestecktes Kettenendglied (orange) – Fotos Paul-Scherrer-Institut/Villigen (Schweiz) / David Mannes; Montage: LWL / Corinna Hildebrand
- Die Neutronencomputertomografie zeigt alle Einzelheiten vom Aufbau des Dosenschlosses – Foto Paul-Scherrer-Institut/Villigen Schweiz / David Mannes
- Die im Maßstab 4:1 gefertigte Rekonstruktion des Schlosses mit Kette im geschlossenen Zustand – Rekonstruktion LWL / Eugen Müsch – Foto LWL / Stefan Brentführer
- Der lizenzierte Sondengänger Constantin Fried in Aktion – Foto E. de Bourdeaux






















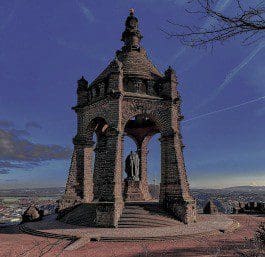
Speak Your Mind