Die Preußen in Münster: Nein, es sind nicht die Preußen in Münster gemeint, die 2024 unter dem Jubel der Bevölkerung in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen sind.
Gemeint ist der Staat Preußen in Münster, dem nach dem Wiener Kongress im Jahr 1815 die Provinz Westfalen zugeschlagen wurde und Münster zur Provinzialhauptstadt aufstieg. Die Integration erfolgte jedoch nicht ohne Probleme, denn in der neuen Provinz gab es zahlreiche Besitzstände mit unterschiedlichen Traditionen und Konfessionen.
Die Provinzialverwaltung förderte zwar ein gemeinsames „Westfalenbewusstsein“. Doch die inneren Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebenswelten im städtischen Westfalen und dem landwirtschaftlichen, dörflichen Umland blieben groß. Hinzu kam, dass die Konfessionsgrenzen von erheblicher Bedeutung waren. Das schlug sich auch in der unterschiedlichen politischen Kultur nieder.
Die Provinz Westfalen war verwaltungsmäßig in die Regierungsbezirke Arnsberg, Minden und Münster eingeteilt. Deshalb versuchte die preußische Verwaltung für eine Angleichung der politischen Institutionen und Verwaltungseinrichtungen zu sorgen. So gab es im Rechtswesen traditionell erhebliche Unterschiede.
Zur Vereinheitlichung des Rechtswesens wurde zum 1. Januar 1900 in allen Teilen Westfalens das Bürgerliche Gesetzbuch eingeführt. Die administrative Eingliederung in den preußischen Gesamtstaat betrieb vor allem der erste Oberpräsident Ludwig von Vincke.
Als Ende 1871 der sogenannte Kulturkampf begann, hinterließ der Konflikt in Preußen nirgends so tiefe Spuren wie in Münster, dem sogenannten „Rom des Nordens“.
Der Kulturkampf wurde hier besonders heftig geführt, denn es war ein Kampf zwischen der Bewahrung der katholischen Tradition und der Anpassung an die vom protestantischen preußischen Staat repräsentierte Moderne.
Der Kulturkampf vollzog sich in Münster, einer Stadt, in der sich 90 Prozent der Bevölkerung zum Katholizismus bekannte und auf eine Gesellschaft, in der die Kirche noch einen erheblichen Einfluss ausübte. Kein Wunder, dass sich die Kirche in ihrer Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit vom Staat bedroht fühlte.
Folgende Maßnahmen wurden in Berlin getroffen, die das Leben in Münster maßgeblich veränderten:
- Juli 1871: Bismarcklöst die katholische Abteilung im preußischen Kultusministerium auf.
- März 1872: Die geistliche Schulaufsichtwird in Preußen durch eine staatliche ersetzt (Schulaufsichtsgesetz).
- Maigesetze1873: Der Staat kontrolliert Ausbildung und Einstellung der Geistlichen, gewählte Gemeindevertretungen verwalten das kirchliche Vermögen.
- Januar 1874: Vor dem Gesetz ist nur noch die Eheschließung des Standesamtes gültig (Zivilehe), nicht mehr die kirchliche. Wer kirchlich heiraten wollte, durfte dies erst nach der standesamtlichen Trauung.
- April 1875: Das „Brotkorbgesetz“ entzieht der Kirche die staatlichen Zuwendungen.
- Juni 1875: Das „Klostergesetz“ löst die Klostergenossenschaften in Preußen auf, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf die Krankenpflege beschränkten.
Bei der Durchsetzung dieser Maßnahmen kam es in Münster zu aufruhrähnlichen Zuständen und im Jahre 1875 sogar zur Anordnung der Verhaftung von Bischof Johannes Bernhard Brinkmann, der jedoch in die Niederlande flüchtete.
Von Vincke hat als entscheidende Reformen die Aufhebung der Leibeigenschaft in Verbindung mit der Erbuntertänigkeit, eine neue Gewerbeordnung und die kommunale Selbstverwaltung der Städte durchgesetzt.
Nach der Niederschlagung des Wiedertäufer-Reiches in Münster im Jahr 1535 und der anschließenden katholischen Gegenreformation hatte der Protestantismus für die nächsten 300 Jahre keine Chance, um in Münster Fuß zu fassen.
Erst durch die Eingliederung von Westfalen als Provinz in den Staat Preußen bildete sich wieder eine evangelische Gemeinde. Entscheidend war, dass es sich bei den in Münster von Berlin aus angesiedelten preußischen Beamten zumeist um Protestanten handelte, die von den ansässigen Bewohnern häufig als fremde Besatzer betrachtet wurden.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erhöhte sich die Zahl der Protestanten in Münster deutlich durch den Zuzug von Flüchtlingen, die sich insbesondere in den damaligen Randbereichen der Stadt niederließen, wo sie neue Kirchengemeinden gründeten.
















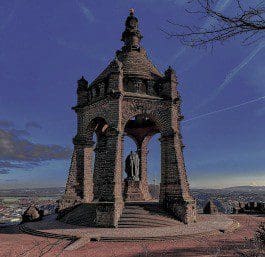
Speak Your Mind